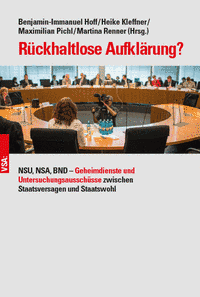Heimat und das Janusköpfige des Nationalen
Im September 2017 lud die Friedrich-Schiller-Universität (FSU) Jena Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Studierende ein, gemeinsam das Thema Heimat im Spannungsfeld von Globalisierung und neu aufloderndem Nationalismus auszuloten. Selten war eine langfristig geplante Konferenz so tagesaktuell – ist sie es auch heute noch.
Nur wenige Tage später zog im Ergebnis der Bundestagswahl 2017 die sogenannte Alternative für Deutschland (AfD) mit über 90 Abgeordneten in den Deutschen Bundestag ein. Nachdem im Frühjahr 2018 die längste Phase in der Regierungsbildung des Nachkriegsdeutschlands abgeschlossen wurde, übernahm der bis dahin als bayerischer Ministerpräsident amtierende CSU-Politiker Horst Seehofer das neugebildete Bundesministerium des Inneren, für Bauen und Heimat. Soviel Heimat war selten im politischen Diskurs, doch zeigte der im Frühsommer des Jahres 2018 von der bayerischen Regionalpartei CSU vom Zaun gebrochene Konflikt um das bundesdeutsche Grenzregime, dass unter der Flagge der „Heimatpolitik“ unterschiedliche Schiffe segeln können. Orientieren die einen auf Rückbesinnung in einer sich vermeintlich immer schneller drehenden Welt von Globalisierung und Technisierung, fokussieren andere auf einen diskursiven Frame-Wechsel, in dem klassische Regional- und Landespolitik im föderalen Bundesstaat als „Heimatpolitik“ neu definiert wird. Dritte wiederum definieren Heimat sowohl ethnisch als auch anti-modernistisch. Im Anschluss an nationalistische und national-konservative Politiken, als deren Vorbild die ungarische Regierungspolitik Viktor Orbans beispielhaft angesehen werden kann, wird eine tektonische Verschiebung im bisherigen bundesdeutschen Werte- und Politikverständnis angestrebt. Während die AfD diese Zielstellung programmatisch offen formuliert, nehmen die CSU und ihr nahestehende Teile der CDU – mit dem Ziel, die Zustimmungsbasis der AfD erodieren zu lassen – eine Positionsveränderung vor. Würde sich diese Veränderung durchsetzen, stünde die Bundesrepublik Deutschland gemeinsam mit dem von ÖVP und FPÖ national-konservativ regierten Österreich näher an den sogenannten Visegrad-Staaten, die Ivan Kastev mit Blick auf Polen und Ungarn als „illiberale Demokratien“ benennt, als an den bisherigen engsten Verbündeten wie Frankreich und den Niederlanden.
Wie sich zeigt, ist eine wissenschaftliche Tagung über „Heimat“ angesichts dessen keineswegs ein Ort weltfremder Debatten im Elfenbeinturm, sondern vielmehr ein Ort, an dem ins Auge des gesellschaftlichen Diskurses geschaut wird. Dass an der Friedrich-Schiller-Universität der alte Diskurs über Heimat neu geführt wird, ist eine Zwangsläufigkeit. Ist er doch auf das Engste mit der wissenschaftlichen Tätigkeit an der „Salana“ oder dem „Collegium Jenense“ verquickt.
Erinnert sei an die Frühromantiker, mit deren Wirken die Universität Jena für kurze Zeit zum „eigentlichen Sitz der geistigen Bestrebungen in Deutschland“ aufstieg. Vor mehr als 200 Jahren machten sie Jena zu einer globalen Metropole der Dichtung und Philosophie. Sie rissen die Trennwände zwischen Literatur und Alltagserfahrung nieder und luden jede Tätigkeit mit poetischer Bedeutsamkeit auf.
In ihrem Gefolge wurde der Begriff der Heimat neu reflektiert und zu einer Idylle verklärt, die sich dem Siegeszug von Industrie, Empirie und Rationalität bewusst verweigern sollte, wie im 2016 erschienenen Sammelband „Heimat gestern und heute“, herausgegeben von Costadura und Ries, nachgelesen werden kann. Dieser Band gab bereits einen Vorgeschmack auf die Interdisziplinarität, mit der das Thema „Heimat“ behandelt werden kann und wohl auch muss.
Die Aula der Universität Jena dominiert das Gemälde „Auszug der deutschen Studenten in den Freiheitskrieg von 1813“ von Ferdinand Hodler. Dieses oft beschriebene Gemälde ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Es verweist darauf, dass Geschichte nie abgeschlossen und stets von Ambivalenzen bis hin zu ironischen Widersprüchen geprägt ist. „In unseren Tagen scheint ein jedes Ding mit seinem Gegenteil schwanger zu gehen“, sagte Marx am 14. April 1856 in London – daran hat sich auch in den vergangenen 161 Jahren nichts geändert.
Das Hodler-Gemälde wird in diesem Beitrag zunächst für zwei Exkurse genutzt. Daran schließt sich ein Blick auf den jährlich von Wissenschaftler/-innen der FSU im Auftrag der Landesregierung Thüringens erhobenen „Thüringen-Monitor“ an. Im letzten Abschnitt wird gezeigt, dass eine progressive gesellschaftliche Linke mit der Renaissance des Heimatdiskurses nicht hadern muss. Vielmehr ist sie bestens für diesen Diskurs gerüstet.
Von den „Höhen von Sedan“ zum Händereichen in Verdun
Das Werk „Auszug der deutschen Studenten in den Freiheitskrieg von 1813“ wurde von der "Gesellschaft der Kunstfreunde von Jena und Weimar" in Auftrag gegeben. Es versinnbildlicht den anti-napoleonischen Kampf. Es steht in seinem Bezug auf die Studenten auch für die frühe Burschenschaftsbewegung und wurde 1909 in der Universität enthüllt.
Nur fünf Jahre später forderte der Jenaer Literaturnobelpreisträger Rudolf Eucken, der im Übrigen Mitglied der „Gesellschaft der Kunstfreunde von Jena und Weimar“ und somit einer der Auftraggeber war, die sofortige Entfernung des Gemäldes. Der Grund: Im Sommer 1914, wenige Wochen nach Beginn des zerstörerischen 1. Weltkrieges, unterzeichnete der Künstler Ferdinand Hodler nach der Bombardierung der Kathedrale von Reims durch deutsche Truppen eine Petition, die diese Zerstörung französischen Kulturgutes zutreffend als Barbarei brandmarkte.
Während Hodler die Universalität der Freiheit der Kunst zu verteidigen bereit war, sah Eucken – man muss es noch einmal betonen – immerhin Literaturnobelpreisträger und damit quasi ernanntes Mitglied der Internationale der Kulturschaffenden – keinen Wert im Schutz französischen Kulturgutes. Der Sozialdemokrat Alfred Grotjahn formulierte seinerzeit spöttisch, wie u.a. Hosfeld in seiner Tucholsky-Biografie erinnert: „Man wird sich ein Verzeichnis bisher geschätzter Personen anlegen müssen, die durch den Krieg eine akute Geistesverwirrung erlitten haben."
Doch Eucken war beileibe nicht allein mit seiner Auffassung. Die Zahl der Intellektuellen, die 1914 in Deutschland in einen nationalistischen Kriegstaumel gerieten, war groß. Euckens Schriftstellerkollege Thomas Mann notierte "Krieg! Es war Reinigung, Befreiung, was wir empfanden", und der Theaterkritiker Alfred Kerr schrieb: "Hunde dringen in das Haus - Peitscht sie raus!".
Um der Wahrheit Rechnung zu tragen muss zugegeben werden, dass selbst Heroen der Sozialwissenschaft, wie Max Weber, Georg Simmel oder Werner Sombart, vom Kriegstaumel nicht frei waren. Auch wenn, wie Hans-Ulrich Wehler in Band 4 seiner Deutschen Gesellschaftsgeschichte feststellt, kaum ein anderer den leidenschaftlichen Ausbruch Thomas Manns zu übertreffen vermochte.
Am Ende übrigens wurde Euckens Wunsch, das Gemälde zu entfernen, nicht entsprochen. Verhüllt durch Bretter überstand es die Kriegsjahre und war ab 1918 wieder zugänglich. Die Lehre aus dieser Anekdote ist zunächst die, dass auch Künstlerinnen und Künstler vor Irrwegen des Nationalismus nicht gefeit sind. Und dass manchmal nur eine Handvoll Bretter genügt, um Verirrungen unschädlich werden zu lassen.
Das Hodler-Werk und die Kontroverse um es verweisen uns freilich in der rückblickenden Betrachtung darauf, dass der Weg auf dem die deutschen Studenten auszogen, vom anti-napoleonischen Befreiungskrieg mehrheitlich in nationalistischen Hass und die Katastrophen des 20. Jahrhunderts führten. Seit 1815 Avantgarde der deutschen Nationalbewegung, wurzelnd in den Freiheitskriegen, trugen die deutschen Burschenschaften mit dem Wartburgfest, das sich 2017 zum 200. Mal jährte, und dem Hambacher Fest 1832 zur organisierten Vertretung nationaler, radikal-republikanischer Forderungen bei.
Es war, wie Karl Heinrich Brüggemann feststellte, die „erste Formulierung und Proklamation der Grundrechte des deutschen Volkes“. Dass die Proklamation der Grundrechte des deutschen Volkes in den kommenden einhundert Jahren mit einer dramatischen Überhöhung des Deutschen einhergehen würde, war im Wartburgfest ebenso wenig natürlich angelegt, wie im Hambacher Fest. Dennoch entstand im Gefolge eines deutschen Nationalismus eine von Hass getriebene Erbfeindschafts-Psychose. Ihre Ursache hatte sie in der Überhöhung des Deutschen und der Entwertung anderer Völker.
Diese Vorstellung war in wichtigen Protagonisten und Theoretikern dieser Zeit bereits angelegt. Insbesondere Ernst Moritz Arndt, um dessen Namensgebung einer deutschen Universität es jüngst eine notwendige Kontroverse gab, aber auch Johann Gottlieb Fichte waren Stichwortwortgeber anti-französischer Ressentiments. Beispielhaft sei E.M. Arndts bereits 1813 erschienene Schrift: „Über Volkshaß und über den Gebrauch einer fremden Sprache“ zitiert. In ihr droht bereits der Titel an, was das Werk enthält: "Ich will“, so Arndt, „den Haß gegen die Franzosen, nicht bloß für diesen Krieg, ich will ihn für lange Zeit, ich will ihn für immer. Dann werden Teutschlands Gränzen auch ohne künstliche Wehren sicher seyn, denn das Volk wird immer einen Vereinigungspunkt haben, sobald die unruhigen und räuberischen Nachbarn darüber laufen wollen. Dieser Haß glühe als die Religion des teutschen Volkes, als ein heiliger Wahn in aller Herzen, und erhalte uns immer in unserer Treue, Redlichkeit und Tapferkeit.“
Diese Art bellizistisches Gedankengut, das unter den Burschenschaftlern kursierte, führte letztlich auf den „Höhen von Sedan“ wie auf den Feldern von Verdun zu Abertausenden Toten im Namen der Heimat. Es bedurfte des Schreckens zweier Weltkriege, damit das entstand, was heute als deutsch-französische Freundschaft zum Kernbestand unserer europäischen Identität gehört. Es muss daran erinnert werden, wenn – wie oben dargestellt – die Achse Berlin-Paris zu einer, wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sich ebenso geschichtsvergessen wie politisch dramatisch ausdrückte, Achse Berlin-Wien-Rom verschoben werden soll.
Erinnern im Nachgang zur Bundestagswahl 2017
Auch an den Jenenser Studenten, die 1813 gegen Napoleon auszogen, zeigt sich das Janusköpfige des Nationalen: Ohne die Akzeptanz der Universalität des Geltungsanspruchs der Menschenrechte, was impliziert, dass diese Menschenrechte überall, also räumlich unbegrenzt quasi in jeder Heimat zu gelten haben, besteht zwischen der Forderung nach nationaler Freiheit und Selbstständigkeit und der radikalen Ablehnung des Anderen keine Grenze.
Schon die Romantik verstand sich als Gegenbewegung zu den Umbrüchen, die mit der Französischen Revolution und in ihrem Gefolge einhergingen. Sie reflektierte, idyllisierte und poetisierte die Heimat bewusst gegen die als zu kalt empfundene Rationalität der Moderne. Die gleiche Gegenbewegung zeigte sich in dem „Heimat-Hype um 1900“, wie Costadura/Ries darstellen. In fast allen Bereichen des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens. Die „Industriemoderne“ als zweite Moderne führte, wie Costadura/Ries zeigen, zur Entstehung unterschiedlichster Gegenbewegungen. Im Naturschutz- oder Heimatschutz waren sie eine zeitlich versetzte Reaktionsbewegung auf diese Modernisierungsprozesse, „die zunehmend in nationalistisches und dann auch in völkisches, ja, sogar militaristisches Fahrwasser gerät.“ (2016: 11)
Wohin dies führt, zeigte das im Nationalsozialismus ideologisch aufgeladene, antimodernistische Heimatverständnis des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Der deutsche Heimatbegriff, den es in anderen Sprachen in dieser Form überhaupt nicht gibt, wurde mit biologistischen und rassistischen Begründungen untersetzt und definierte Zugehörigkeit. Dies markierte für die Ausgegrenzten – sofern sie nicht ihre Heimat verlassen konnten, die ihnen aber als Heimat ideologisch verweigert wurde – letztlich den Weg in die Lager und damit in den sicheren Tod. Blut und Boden, Rasse, Biologie wurden, so Costadura/Ries, an Heimat gebunden – der Staat selbst zur Heimat erklärt. Erst die Befreiung vom Nationalsozialismus durch die Alliierten stellte die Allgemeingültigkeit der Menschenrechte wieder her.
In dialektischer Ironie entsteht freilich genau durch die Ausgrenzung im nationalsozialistischen Heimatverständnis ein neuer Heimat-Begriff, der bis heute Wirkung behält. „Die massive Fluchtbewegung [im Nationalsozialismus] schafft nunmehr ein neues Heimatverständnis oder neue Reflektionen über Heimat […], nämlich ‚Heimat im Exil‘, das Heimatverständnis der Exilanten, der Thomas Mann, Stefan Zweig, Lion Feuchtwanger, Herrmann-Neiße, u.a. Dieses neuartige Reflektieren über Heimat (kann man eine neue Heimat im Ausland, in der Fremde finden?) ist das Produkt eines mindestens hundert Jahre alten, vielleicht um 1830/40 im Vormärz einsetzenden Reflektionsprozesses, in welchem Heimat als metyphysische Größe diskutiert wurde.“ (Costadura/Ries 2016: 15)
Wenn der AfD-Politiker Gauland einen Schlussstrich unter die deutsche Geschichte ziehen wollte, stolz auf die „Leistungen der Wehrmacht“ ist und den Holocaust einen „Fliegenschiss“ der Geschichte nennt, dann ist es immer und immer wieder nötig, an diese tragischen Linien zu erinnern. Und es entsteht die Notwendigkeit, den Begriff der Heimat zu entmystifizieren – ihn dadurch dem Zugriff rechtspopulistischer oder offen rechtsextremer Instrumentalisierung zu entziehen.
„Meine Heimat DDR“ oder Geschichts-Instrumentalisierung zur Konstruktion einer „sozialistischen Nation“
Ein Landespolitiker der Partei Die LINKE, eine Landesregierung, in der DIE LINKE, SPD und Grüne zusammengeschlossen sind, stehen vor der historischen Notwendigkeit, über das komplizierte Verhältnis der Partei- und Staatsführung der DDR zu Heimat und Nation nicht zu schweigen.
Die DDR war ein Staat, der nicht zur Nation wurde und die Heimat deshalb als Nationsersatz entdeckte. Auf dieser Grundlage sollte Legitimation für den Staat hergestellt werden. Dabei war das DDR-Heimatverständnis stets gekoppelt – nie widerspruchsfrei – an die positive Bezugnahme auf die internationalistische Tradition der sozialistischen Bewegung. Zudem war die DDR in fast besinnungsloser Treue verankert in der sozialistischen Staatengemeinschaft. Welche Folgen dies hatte, zeigte die uneingeschränkte Unterstützung der Niederschlagung emanzipatorischer Bewegungen und Aufstände in den sozialistischen Staaten. Sei es 1953 in der DDR selbst gewesen oder 1956 in Ungarn, 1968 in der Tschechoslowakei oder Anfang der 1980er Jahre in Polen. Diese Staatengemeinschaft verkörperte die Materialisierung der metaphysischen Idee des Übergangs in die sozialistische Zukunft, die Realität werden sollte und wurde – zumindest in den Beschlüssen der Partei- und Staatsführungen.
Der Autor und die Autorin dieses Textes sind aufgewachsen in der DDR. In sehr unterschiedlichen Milieus. Staatsnah der eine, staatsfern und kirchlich orientiert die andere. Auch wenn die Kinderhymne von Brecht zum kulturellen Kanon gehörte, hießen die Liedzeilen der DD-Kindheit z.B. in „Unsere Heimat“:
„[…] Und wir lieben die Heimat,
die schöne und wir schützen sie,
weil sie dem Volke gehört,
weil sie unserem Volke gehört.“
oder in „Gute Freunde“:
„Sie schützen unsre Heimat
Zu Land, zur Luft und auf der See,
Sie schützen unsre Heimat
Zu Land, zur Luft und auf der See.
Gute Freunde, gute Freunde,
Gute Freunde in der Volksarmee.“
Freilich war die räumliche Begrenztheit der Heimat offensichtlich, denn in Ost-Berlin endeten alle Querstraßen zur Straße, in der der Autor wohnte, Richtung Nordwesten in Sackgassen. Darüber nachgedacht hat der Autor erst 1989, als sich die neue Heimat räumlich erweiterte und die Heimat DDR, verloren ging.
Nicht alle empfanden in gleicher Weise. Viele sehr gegensätzlich. Der Vater eines Mädchens, der Mitte der 80er Jahre in den Westen ausreiste. Die beiden konnten sich fortan nur noch über die Mauer hinweg zuwinken – sofern es behördlicherseits keinen Ärger diesbezüglich gab.
Hierzu formulierte anlässlich der Verleihung des Georg-Büchner-Preises 2002 der Schriftsteller Wolfgang Hilbig bemerkenswert zutreffend: „Man hatte mir plötzlich mit staatlicher Gewalt und, das war bald darauf zu erkennen, mit Waffengewalt, eine Heimat verschafft, und man hatte mich nicht gefragt, ob ich diese Heimat haben wollte. Man hatte versucht, mit Gewalt ein Heimatgefühl in mir zu erzwingen – wenn es ein Mittel gibt, in einem Menschen, in seinem Herzen, in seinem Kopf, ein sogenanntes Heimatgefühl dauerhaft auszuschließen, dann ist es genau dieses Mittel staatlicher Gewalt.“
Das Offensichtliche, wovon also zunächst zu sprechen wäre, ist die seitens der Staatsführung von den DDR-Bürgerinnen und -Bürgern geforderte Loyalität zur Staatsdoktrin. Sowie zum Verständnis der DDR als sozialistischer Nation, wie diese im Zuge der Verfassungsänderung 1974 und dem 25. Jahrestag der DDR dann staatsoffiziell verstanden wurde.
Bemerkenswert in diesem Kontext ist zudem die von Widersprüchen und Ambivalenzen geprägte ideologische Debatte innerhalb der SED und der DDR-Wissenschaft über die Frage, worauf sich die DDR als „sozialistische Nation“ in der deutschen Geschichte beziehen könne. Das ersichtlich nicht einfach umzusetzende Bestreben der DDR- Staats- und Parteiführung, über den Umweg der Auslöschung des gesamtdeutschen Bewusstseins zu einem eigenen Staatsvolk mit eigener nationaler Identität zu gelangen, erzeugte fruchtbare wissenschaftliche Erkenntnisse. Leider liegt dies vielfach außerhalb der Wahrnehmung, da die DDR-Forschung – durchaus nachvollziehbar und dennoch ist ein Wandel dieser Sichtweise wünschenswert und nötig – bislang überwiegend eine Forschung über die SED-Diktatur, also Aufarbeitungsforschung ist.
Bemerkenswert ist dies deshalb, weil die Frage, wie in den beiden deutschen Teilstaaten mit dem Heimat- und Nationbegriff gearbeitet wurde und wie er in der deutsch-deutschen Kontroverse politischen Konjunkturen unterlag, vielleicht auch ein interessanter Aspekt dieser Tagung hätte sein können oder an anderer Stelle einmal beleuchtet werden könnte.
Einem möglichen Vorwurf aufmerksamer Leserinnen und Leser, ob man sich mit diesem Exkurs zu weit von Hodlers Gemälde entfernen würde, ist zu begegnen. Gewählt wurde ein Seitenweg über den preußischen Generalleutnant Scharnhorst, Militärreformer und wesentlicher Akteur der Befreiungskriege. Er nahm eine bedeutende Rolle bei der Suche in der DDR nach Vorbildern ein, die z.B. für eine historisierende Legitimation der Nationalen Volksarmee über die Rote Ruhrarmee und die Roten Matrosen dienstbar waren.
Im Zentrum einer solchen Betrachtung, die hier naturgemäß nur kurz ausfallen kann, steht die 1944/1945 im mexikanischen Exil entstandene Schrift „Der Irrweg einer Nation“ des späteren DDR-Kulturministers Alexander Abusch. Gunnar Decker zeichnet in seiner hervorragenden Monographie über das sogenannte Kulturplenum der SED von 1965, dessen gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen sowie Wirkungen, ein klares Bild der tragischen Rolle des Dogmatikers Abusch.
Wie Wernicke in einem lesenswerten Aufsatz über das Preußen-Bild in der DDR ausführt, brachte „die vom NS-Regime verschuldete Katastrophe […] in allen Teilen der Gesellschaft tiefgreifendes Nachdenken über deren Ursache hervor. Dabei wurde nicht übersehen, daß die einfache Abwälzung der Schuld auf den Nazismus zu kurz griff, denn auch der hatte ja nicht wurzellos in der deutschen Gesellschaft emporsprießen können. Und da boten sich – wie es nach Katastrophen üblich ist – einige einfache Lösungen an, die in allen Besatzungszonen ihre Kolporteure fanden.“
Zwei zentrale Lösungswege, die Abusch in seinem Werk aufgreift, seien hier betrachtet: Einerseits das Preußen-Bild, denn der preußische Militarismus hatte nun als wesentliche Ursache für Kadavergehorsam und Untertanengeist zu dienen, sowie andererseits ein Bild von Martin Luther als Totengräber der Nation, der Verkörperung der Gegenrevolution und reaktionärer Haltungen.
Beide Bilder wurden im Verlauf der DDR-Geschichte revidiert. Hinsichtlich des Preußen-Bildes gab es durchaus zahlreiche Linien - von einer grundsätzlichen Ablehnung des preußischen Erbes, manifestiert in der Person von Friedrich II., über eine differenzierte Betrachtung preußischer Modernisierungen u.a. im Staatswesen, repräsentiert durch Freiherrn von Stein, oder im Militärapparat in Form des bereits genannten Generals von Scharnhorst oder seinem Zeitgenossen von Gneisenau - bis hin zu positiven Einschätzungen. Stets aber spielten politische Interessen eine wichtige Rolle, wenn es zu Akzentverschiebungen in der Bewertung von Personen oder geschichtlichen Ereignissen kam.
Zwischen preußischem Kadavergehorsam und deutsch-sowjetischer Freundschaft
Das ursprüngliche Narrativ des militaristischen Preußen bot nicht nur Anknüpfung an die traditionelle Ablehnung preußischer Obrigkeitsstaatspolitik seitens der politischen Linken unterschiedlicher Parteiencouleur, sondern hatte, wie Wernicke darlegt „für die Arbeiterparteien KPD und SPD [als] vereinfachte Schuldzuweisung den positiven Effekt, daß sie die Arbeiterschaft aus der Schußlinie der prinzipiellen Kritik heraushalten konnte.“ Zugleich konnte auf diesem Wege auch die Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone moralisch legitimiert werden. Es bedurfte freilich eines moderateren, weil differenzierteren Preußen-Bildes, um historisch abgesicherte Vorbilder für die Legitimierung entstehender DDR-Staatlichkeit zu erhalten. Auf die so hergestellte Legitimationskette der preußischen Generäle Scharnhorst u.a. für die Gründung der zunächst Kasernierten Volkspolizei und späteren NVA ist bereits verwiesen worden. Der Rückgriff auf diese Vorbilder bot – quasi als Beifang – zugleich eine weitere historische Legitimationskette: die staatlich vorgegebene „deutsch-sowjetische Freundschaft“ als Weiterführung preußisch-russischer Kooperation in den napoleonischen Befreiungskriegen. Dies muss als Stichworte genügen. Auf die Rezeption Friedrich II. in Form der zum Standardwerk sich herausbildenden Monographie von Ingrid Mittenzwei kann hier nicht eingegangen werden. Sie muss jedoch Erwähnung finden, denn anders als die Entscheidung Honeckers, durch Rückgriff auf die Bezeichnung Friedrich II. als „Friedrich dem Großen“ und die Wiederaufstellung des „Friedrich-Denkmals“ unter den Linden, war Mittenzweis Untersuchung wissenschaftlich abgesichert und nicht instrumentell intendiert.
Die DDR-Bevölkerung machte sich im Übrigen auf diese erneute Volte der Staats- und Parteiführung – wie üblich - ihren eigenen Reim:
Unterschiedlichen Quellen nach wurde in Berlin die Wiederaufstellung des Reiterstandbildes von Friedrich II. mit den Worten kommentiert: „Lieber Friedrich, steig hernieder und regiere Preußen wieder. Lass in diesen schweren Zeiten lieber unsern Erich reiten.“
Luther - Fürstenknecht oder Revolutionär und deutschlandpolitisch gewandelte Müntzer-Bilder
Das Luther-Bild der DDR war einerseits geprägt von der dichotomen Gegenüberstellung des „Fürstenknechts“-Luther im Verhältnis zum Bauernführer Thomas Müntzer - (Mühlhausen liegt übrigens wie Jena in Thüringen, woran an dieser Stelle mit Blick auf kulturtouristische Interessen erinnert sei) -,der die eindeutig positive Bezugsfigur lieferte. Dabei war auch das Müntzer-Bild übergeordneten politischen Konjunkturen unterworfen. Wurde ursprünglich Thomas Müntzer als erster deutscher Revolutionär skizziert, der für die Einheit Deutschlands gekämpft hatte, wurde diese Perspektive mit der Konstituierung einer auf die DDR als sozialistische Nation bezogenen Staatlichkeit und Verabschiedung von gesamtdeutschen Vereinigungsszenarien zu einem Teil der angestrebten eigenständigen Geschichtstradition. Prägend dafür war das Narrativ der „frühbürgerlichen Revolution“, das – wie Porada in einer Rezension von Fleischauer und Scheunemann darlegt, „ursprünglich auch die Funktion hatte, die Reformation als epochales Ereignis in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit zu überlagern“.
Die DDR inszenierte die Jubiläen des 400. Geburtstags von Philipp Melanchthon im Jahre 1960, des 450. Jahrestags der Reformation sowie im selben Jahr die 900-Jahr-Feier der Wartburg als kulturtouristische und polit-historische Ereignisse. Luther wurde der Figur des „Fürstenknechts“ partiell entkleidet und zum Initiator eines revolutionären Prozesses von nationaler Bedeutung, womit er sich auch im Verhältnis zu Thomas Müntzer einordnen ließ. Diese Inszenierungen waren freilich mit weniger Irritationen verbunden als der Coup, den Erich Honecker landete, als er quasi ohne Vorwarnung 1983 anlässlich des 500. Geburtstages von Luther als von einem der bedeutendsten Söhne Deutschlands sprach. Honecker stellte nicht nur das vorherrschende vereinfachte Luther-Bild, das bis dahin die Schulbücher dominierte in Frage, sondern auch die Kirchen in der DDR vor enorme Herausforderungen, die sich auf einmal in staatsoffizielle Aktivitäten eingebunden sahen, die ohne Zweifel instrumentellen Charakter hatten. Sie spitzten zudem innerkirchliche Kontroversen über den Umgang mit der Staatsführung und über die Rolle der Kirchen im Verhältnis zur DDR-Gesellschaft zu. Vor einigen Monaten habe ich hier an gleicher Stelle vor der historischen Kommission des Landes Thüringen über die Diskriminierung von Kirchen in der DDR referiert. Darauf sei hier verwiesen, ohne dies weiter ausführen zu können.
Was Honecker mit seinem Coup gelang, war in jedem Falle, auch die Bundesrepublik im Hinblick auf ihre Aktivitäten zum Luther-Jubiläum in Zugzwang zu bringen. Die internationale Öffentlichkeit, die er sich mit Blick auf die Königshäuser der Niederlande, Dänemarks u.a. erhofft hatte, blieb freilich aus. Das heute noch bestehende Kaberett „Die Distel“ kommentierte die staatsoffiziellen Luther-Feierlichkeiten und das neue Luther-Bild 1983 ironisch mit den Worten:
„Kuddeldaddeldu, immer schnieke und schmuck
Und passend jekleidet vom Kiel bis zum Trupp
Kommt heute abend im Lutherlook.
Ein Mönch, wie stolz das klingt:
Denn Luther is unser schon immer jewesen
Schon wejen der Thesen,
denn 95 auf einen Schlag
hatten wir nicht mal zum 30. Jahrestag.
Kurz mit Herrn Luther – is alles in Butter.“
Heimat als mehrdimensionaler Begriff und notwendiger Fokus interdisziplinärer Forschung
Dievorstehenden Exkurse sollen untermauern, was für die Organisatorinnen und Organisatoren dieser Tagung ersichtlich Ausgangspunkt der Zusammenstellung des Tagungsprogramms war: Heimat ist ein multidimensionaler Begriff, der interdisziplinär bearbeitet werden muss, um ihm gerecht werden zu können. Ihm gerecht zu werden, ist zweifellos notwendig.
Denn im gegenwärtigen politischen Alltag oszilliert die Verwendung des Begriffs Heimat – je nach politischem Kontext – zwischen Vorurteilen von links und mystifizierender Instrumentalisierung von rechts. Dadurch erscheint Heimat oftmals in einer kulturellen Verengung verhaftet, in einer Entweder-oder-Logik: als Dichotomie des Eigenen und des Fremden.
Dies erinnert an den zum Klassiker mutierten Ausspruch des Galliers Methusalix im Asterix-Band „Das Geschenk Cäsars“:
„Ich hab' nichts gegen Fremde.
Einige meiner besten Freunde sind Fremde.
Aber diese Fremden da sind nicht von hier!"
Im rechtspopulistischen Spektrum geht Heimat einher mit der Vorstellung von ethnischer Kohärenz, die zur Grundlage staatlicher Souveränität erklärt wird. Das Eindringen des Fremden in das Eigene provoziert Ängste vor kultureller Überfremdung und dem Verlust von existentiellen Sicherheiten.
In diesem Zusammenhang beobachten wir die Revitalisierung des Mythos vom geeinten christlichen Abendland, dem schon Novalis und Schlegel mit Blick auf die politischen Verhältnisse des frühen 19. Jahrhunderts nachtrauerten – mit Karl dem Großen als zentralem Bezugspunkt.
In der Nachfolge der Romantiker wurde der abendländische Raum patriotisch aufgeladen und gegen die Ideen der Französischen Revolution gerichtet oder als Verbindung von Antike, Christentum, germanischen und romanischen Völkern definiert, wobei die slawischen Völker jedoch explizit ausgeschlossen wurden, bis schließlich Oswald Spengler 1918 den Untergang des Abendlandes als Zivilisation prognostizierte.
Auch heute ist der Begriff des Abendlandes als Vokabel der Ausgrenzung wieder virulent und wird gezielt eingesetzt, um Länder islamischen Glaubens zu deklassieren. Auf Auswüchse islamistischen Fundamentalismus antworten Teile der westlichen Öffentlichkeit mit einem Diskurs der Ausgrenzung, der Grundwerte und Menschenrechte allein für den Westen reklamiert. In diesem Diskurs wird bewusst die suggestive Kraft verschwiegen, mit der der Orient über Jahrhunderte auf die europäische Kultur einwirkte. Ohne die Vermittlung der arabischen Hochkultur wäre zum Beispiel das Erbe der Antike in Europa in Vergessenheit geraten.
An anderer Stelle in einem kleinen Beitrag über Konservatismus hat der Autor dieses Textes darauf hingewiesen, dass der Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow, dem vorsätzlichen Irrtum einer christlich-jüdischen abendländischen Leitkultur, der sich die Muslime anzupassen hätten, den interreligiösen Klammerbegriff der "abrahamitischen Religionen" entgegensetzt. Unsere Wertetraditionen beziehen sich normativ auf die Aufklärung und kulturell auf die unterschiedlichen Einflüsse des Christentums, des Judentums und der arabischen Philosophie und Kultur. Bereits Goethe formulierte im "West-östlichen Diwan": "Wer sich selbst und andere kennt | Wird auch hier erkennen: | Orient und Okzident | Sind nicht mehr zu trennen."
Heimat: universaler statt segregierter oder exklusiver Möglichkeitsraum
Es gehört zu den großen Herausforderungen der Gegenwart, so wichtige Begriffe wie Heimat kognitiv und affektiv so zu besetzen, dass sie von allen als Möglichkeitsraum verstanden werden.
Im Einleitungsbeitrag ihres Sammelbandes, den Costadura und Ries als „Heimat – ein Problemaufriss“ verweisen die Autoren auf die 2016er Jahrestagung der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft, die unter der Überschrift „heimatlos/Verlust und Traumatisierung – Sehnsucht und Hoffnung“ durchgeführt wurde.
Verlusterfahrungen und Traumatisierungen sind für ein ostdeutsches Bundesland wie Thüringen – also einem Gemeinwesen mit einer überwiegenden Population von Deutschen mit „sozialistischem Migrationshintergrund“, wie es im SPIEGEL einmal hieß, auch heute noch prägend.
Seit 2002 wird mit dem „Thüringen-Monitor“ eine jährliche Bevölkerungsbefragung in Thüringen vorgenommen. Hintergrund dieser Langzeitbeobachtung, die es in dieser Form in keinem anderen deutschen Bundesland gibt, war die übereinstimmende Entscheidung der politischen Akteure, auf die Schändung der Erfurter Synagoge nicht allein mit den üblichen Betroffenheitsritualen zu reagieren, sondern eine evidenzbasierte Ursachenforschung und empirische Beobachtung des gesellschaftlichen Bewusstseins vorzunehmen.
Im Kontext des im Jahre 2014 gewählten Themenschwerpunkts „Die Thüringer als Europäer“ wurde erneut die Frage erhoben, ob die Befragten sich „in erster Linie als Thüringer, Ostdeutscher, Deutscher oder als Europäer“ fühlen. „Die Identifikation mit einer dieser Bezugsgruppen gewinnt ihre Bedeutsamkeit dadurch“, so die Forschergruppe um Heinrich Best, „dass sie die Verhältnisse der Menschen zu ihrem sozialen Umfeld rahmt. Die Erhebung der Gruppenidentifikation kann darüber Aufschluss geben, wie und entlang welcher Dimensionen das soziale Nah- und Fernfeld in Eigen- und Fremdgruppen eingeteilt wird. Dieser sozialpsychologische Mechanismus ist relevant, da entlang der Gruppeneinteilungen auch Abwertungen von Fremdgruppen und Aufwertungen von der Eigengruppe sowie diverse Zuschreibungen und Stereotypen vorgenommen werden.“
Die regionale Identität ist, wie die Ergebnisse aus 2014 zeigen, von erheblicher Relevanz. Knapp die Hälfte der Befragten äußerte, dass sie sich vorrangig als Thüringerin oder Thüringer sehen. Etwas mehr als ein Viertel gab an, sich als Deutscher zu sehen, weitere 14 Prozent sahen sich als Ostdeutsche, während sich 8 Prozent als Europäerin oder Europäer einordneten. Diese Selbstzuschreibungen sind über die Zeitläufte der Erhebungen stabil. Die Selbstzuschreibung als Thüringer/-in ist unabhängig vom sozialen Status und überwiegt in allen Sozialkategorien, während die Selbstbeschreibung als Europäer/-in eine starke Korrelation zum höchsten Bildungsabschluss hat. Zwar liegt sie auch hier mit 17 Prozent hinter dem Selbstbild als Thüringer/-in oder Deutschen, dennoch hat der Bildungsweg auch einen Einfluss auf die Wahrnehmung von Europa als Möglichkeitsraum, zum Beispiel durch Mobilitätschancen.
In einem vergleichsweise umfangreichen Beitrag würdigte die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 16. November 2016 den Thüringen-Monitor, der im vergangen Jahr unter der Überschrift „Gemischte Gefühle: Thüringen nach der ‚Flüchtlingskrise‘“, stand, wobei der Begriff „Flüchtlingskrise“ nicht leichtfertig dem öffentlichen Diskurs folgend verwendet, sondern bewusst in Anführungszeichen gesetzt wurde.
Es zeigt sich, dass in dem, was der Thüringen-Monitor weiterhin bestehende „Ost-Deprivation“ nennt, die Wiedervereinigung noch nicht abgeschlossen ist. Ostdeutsche – unabhängig von der individuellen sozialen Lage – fühlen sich in der Bundesrepublik weiterhin nicht in ihrer Lebensleistung anerkannt, trauern in diesem Sinne einer Heimat nach und bewerten aus dieser Perspektive das, was Heinrich Best und Kolleg/-innen in der Konsequenz „für Ostdeutschland spezifische Belastungen für die Integration“ nennen.
Die deutsche Einheit sei, so die Erkenntnis des letztjährigen Thüringen-Monitors, von „intakten Solidaritätsnormen einer nationalen Gemeinschaft“ getragen worden. Deshalb ist trotz Massenarbeitslosigkeit Ost und zum Teil erheblichen Unzufriedenheiten in Ost wie West nie von einer „Vereinigungskrise“ gesprochen worden. Im Gegensatz dazu und im Kontext nicht nur allein hinsichtlich des Ausmaßes, wie Best u.a. formulieren, „einer Zuwanderung von über einer Million Flüchtlingen und Asylsuchenden, weit überwiegend mit einem von der deutschen Bevölkerung markant unterschiedlichen soziokulturellen Hintergrund“, sondern auch im Hinblick auf die spezifischen Umstände ihres Grenzübertritts und der politischen Entscheidungen „über ihren Eintritt in das Gebiet deutscher Verwaltungshoheit“, wie durch den Journalisten Robin Alexander im Buch „Die Getrieben“ fast minutiös nachgezeichnet, wurde von einem großen Teil der Öffentlichkeit einschließlich politischer Verantwortlicher ein „Kontrollverlust“ konstatiert, der zugespitzt als „Staatsversagen“ in den öffentlichen Diskurs Eingang fand.
Die Normen der deutschen Einheit, von Willy Brandt mit den ihm für den 10. November 1989 zugeschriebenen Worten „es wächst zusammen, was zusammen gehört“ für die Ewigkeit festgehalten, haben als Zusammenwachsen zweier als Einheit empfundener Heimaten ersichtlich tiefgreifendere Solidaritätswirkung als die universellen humanitären Normen für die Aufnahme von Flüchtlingen, die kurzlebiger und eingeschränkter wirken. Unter anderem daraus erklärt sich der in der Regel nicht durch Fakten untermauerte Stigmatisierungs- und Krisendiskurs.
Dennoch kommen wir nicht umhin, zu konstatieren, dass zum kollektiven Gedächtnis der Ostdeutschen „das geradezu paradoxe Gefühl einer spezifischen Heimatlosigkeit in der eigenen Heimat“ (Costadura/Ries: 17) gehört. Die beiden Autoren verweisen auf die Zeilen „Da bin ich noch: mein Land geht in den Westen“ aus dem Gedicht „Das Eigentum“ von Volker Braun, doch der ganze Text spiegelt die Zerrissenheit im Rückblick auf die DDR wieder. Einerseits Reaktion auf Transformationsbrüche, die als Verlusterfahrung wahrgenommen werden und andererseits Verzicht auf Idealisierung eines Landes, dessen Grenzen man sich wohl bewusst war. Der Korridor: die Fokussierung auf Wohlfahrt und Möglichkeiten, die in der neuen kapitalistischen Gesellschaft ökonomischen Rationalitäten unterworfen sind.
Der letztjährige Thüringen-Monitor zeigte erneut die gemischte Situation einer stabilen Demokratiezufriedenheit, die von Migrationsbewegungen unbeeindruckt bleibt, bei einer erheblichen demokratieskeptischen bis demokratiefeindlichen Minderheit, die rund 20 Prozent der Befragten ausmacht. Obwohl die Ost-Deprivation eben keine vom sozialen Status abhängige Einstellung ist, zeigt sich dennoch, dass die Bewertung der Demokratie stark von verteilungspolitischer Benachteiligung bestimmt ist: „Unter Personen, die die deutsche Einheit negativ bewerten [also Verlusterfahrungen ihrer ostdeutschen Heimat identifizieren – BIH] und die Einschätzung vertreten, dass Westdeutsche Ostdeutsche als ‚Menschen zweiter Klasse‘ behandeln, gibt es nur 14 Prozent (!) zufriedene Demokrat_innen, aber 41 Prozent Demokratieskeptiker_innen und Demokratiefeind_innen. Hier wirken ebenfalls über lange Zeiträume eingeschliffene Gefühle der Benachteiligung und Ressentiments. Relative Deprivation, die aus Gruppenvergleichen resultiert, in denen die Eigengruppe als benachteiligt wahrgenommen wird, mag die Ursache dafür sein, dass auch im Hinblick auf ihre Positionen in den Status- und Einkommenshierarchien begünstigte Sozialkategorien demokratiefeindliche Einstellungen vertreten“, wie die Wissenschaftler/-innen um Heinrich Best konstatieren. Denn ein Ergebnis des Thüringen-Monitors 2016, das mit vergleichbaren Ergebnissen einer sächsischen Untersuchung unter dem Titel Sachsen-Monitor korreliert, ist durchaus besorgniserregend: 20 Prozent der Thüringer höheren und leitenden Angestellten und Beamten stimmen der Aussage zu, dass eine Diktatur im nationalen Interesse unter bestimmten Umständen die bessere Staatsform sei. „Dies ist“, wie Best u.a. festhalten, „der höchste Wert unter allen Berufsgruppen. [Einer] Berufsgruppe, von der man eigentlich ein besonderes Loyalitätsverhältnis zur demokratischen Ordnung erwarten dürfte.“ Unter Bezug auf den Kasseler Soziologen sprechen die Autoren des Thüringen-Monitors von den „Verbitterten der Mittelschicht“, deren Einstellung zu Diktatur und Demokratie aus einem Deprivationsempfinden gespeist werde.
Die Versperrung von Möglichkeitsräumen durch Ausgrenzung infolge nationaler Abschottung, sozialer Segregation in Form von Gentrifizierung in den Städten oder auch durch Deprivation gesellschaftlicher Eliten, die sich nicht topographisch, sondern politisch und gesellschaftlich heimatlos fühlen, sind Erweiterungen des Diskurses um Heimat, dem auch nach Abschluss der Jenaer Konferenz nachgespürt/nachgegangen werden muss.
„Links ist da wo keine Heimat ist“ – fataler Irrtum
Gleichzeitig zwingt die Welle national-populistischer Bewegungen in Europa dazu, auch linke Gewissheiten zu überdenken, nein mehr noch, in Frage zu stellen.
„Links ist da wo keine Heimat ist“, lautet die Antwort der politischen Linken in Deutschland auf die Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus: „Insbesondere für eine kritische Philosophie weltverändernder Praxis schien und scheint das Schlusswort ‚Heimat‘ [in Ernst Blochs ‚Prinzip Hoffnung‘ – BIH] so unmöglich, unbrauchbar, tabu zu sein. – In der Tat, für die Linke ist ein positiver Bezug auf ‚Heimat‘ vollkommen indiskutabel; das ist die politische Konsequenz eben des Miss-, wie auch Gebrauchs der Heimatideologie, wie sie in die deutsche Geschichte eingeschrieben ist“, formuliert Roger Behrens.
Behrens knüpft damit an, an eine länger bestehende Kontroverse in der politischen Linken, nicht zuletzt über folgende Aussage im Kommunistischen Manifest: „Den Kommunisten ist ferner vorgeworfen worden, sie wollten das Vaterland, die Nationalität abschaffen. Die Arbeiter haben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht haben. Indem das Proletariat zunächst sich die politische Herrschaft erobern, sich zur nationalen Klasse erheben, sich selbst als Nation konstituieren muß, ist es selbst noch national, wenn auch keineswegs im Sinne der Bourgeoisie. […] In dem Maße, wie die Exploitation des einen Individuums durch das andere aufgehoben wird, wird die Exploitation einer Nation durch die andere aufgehoben. Mit dem Gegensatz der Klassen im Innern der Nation fällt die feindliche Stellung der Nationen gegeneinander.“ (Marx/Engels 1961: 479)
Das Spannungsverhältnis zwischen den Interpretationen dieser Aussagen bewegt sich zwischen dem sozialdemokratischen Reformisten Eduard Bernstein, der die Aussage: „Die Arbeiter haben kein Vaterland“ dahingehend zu interpretieren suchte, dass es sich um eine Momentaufnahme im Manifest handeln würde, also Marx und Engels ausdrücken wollten: „Der Satz, dass der Proletarier kein Vaterland hat, wird von dem Augenblick an, wo, und in dem Maße modifiziert, als derselbe als vollberechtigter Staatsbürger über die Regierung und Gesetzgebung seines Landes mitzubestimmen hat, und dessen Einrichtungen nach seinen Wünschen zu gestalten vermag.“, während Lenin in seiner Skizze über Marx zum gleichen Sachverhalt feststellt, dass es „in den entwickelten imperialistischen Ländern […] daher vollkommene Wahrheit […], dass die ‚Arbeiter kein Vaterland haben’ und dass die ‚vereinte Aktion’ des Proletariats wenigstens der zivilisierten Länder, eine der ersten Bedingungen seiner Befreiung’ ist.“
Während Heimat in dieser Kontroverse mit Nation identifiziert und gleichgesetzt wird, lädt Behrens in seiner Bloch-Interpretation den Heimat-Begriff jedem Bezug zur Nation vollkommen entkleidend idealistisch auf und formuliert: „Insofern ist Blochs Heimatbegriff keine Kategorie der Tatsächlichkeit, keine ökonomische Kategorie vom Standort, keine politische Kategorie der Nation, erst recht keine politische Kategorie des Nationalismus oder Chauvinismus. Die von Bloch in den Blick genommene Heimat hat kein Blut und keinen Boden, ganz wörtlich, denn sie ist ja nicht von dieser Welt […]; sie ist eine Kategorie der Möglichkeit, ähnlich dem Begriff vom Reich der Freiheit […]. Heimat ist […] Horizont einer materialistischen Geschichtsphilosophie der Praxis.“ (Behrens o.J.: 10f.)
In dieser Lesart steckt ein interessanter Ansatzpunkt – die Beschreibung von Heimat als Möglichkeitsraum, die vorstehend bereits angesprochen wurde. Die Kontroverse um den Heimatbegriff und die Ablehnung jeder positiven Bezugnahme auf die mit Heimat identifizierte Verlusterfahrungen, die weite Teile der Gesellschaft und insbesondere der traditionell der politischen Linken nahestehenden Milieus angesichts von Entgrenzung aufgrund von Globalisierung und technischem Fortschritt machen, führt zu dem, was Autoren als „soziale Entkopplung der progressiven Milieus“ nennen. Mit den Worten von Hillebrand: „Es ist diese ideologische Entfremdung zwischen den linken Parteien und ihrer historischen Wählerbasis, die im Wesentlichen die schlechten Wahlergebnisse der linken Mitte erklärt. Während die Parteien und Funktionäre sich in zentralen wirtschaftlichen und sozialen Fragen im Sinne von Globalisierung, Europäisierung, Entgrenzung und Liberalisierung positionieren, halten Teile der Unterschicht an Nationalstaat, Patriotismus und traditionellen Werten fest“.
Diesen Befund bestreiten kann man kaum, auch wenn man daraus solche und solche Schlussfolgerungen ziehen kann. Es ist nach der Bundestagswahl 2017 und dem großen Erfolg der AfD wiederholt zutreffend darauf hingewiesen worden, dass mit einem „Rechtsruck“ in Richtung AfD nichts zu gewinnen ist. Dies würde bedeuten, auf der Tanzfläche der AfD nach deren Takt sich zu bewegen. Die Linke kann mit dem Rechtsblinken nichts gewinnen. Entweder sie biegt ab, dann hört sie auf, links zu sein. Oder sie blinkt nur, dann ist das Blinken nicht mehr als ein Hinweisgeber auf das rechte Original.
Aber es gibt für die politische Linke auch keinen Anlass, der Illusion zu erliegen, der Wandel von Milieus, Werten und gesellschaftlicher Diskurse hätte auf uns keinen Einfluss. Wenn die Linke Mehrheiten für eine andere Politik erringen will, dann weder gegen noch ohne die "historische Wählerbasis", von der Ernst Hillebrand schreibt.
Dann wird man erstens nicht umhin kommen, eine progressive politische Erzählung zu entwickeln, die Begriffe wie Sicherheit (als den legitimen Wunsch nach Sicherheit vor den großen Risiken des Lebens, seien sie nun Krieg, Gewalt, Armut oder Diskriminierung) und Heimat (als ebenso legitimen Wunsch nach einem Leben in verlässlichen familiären, sozialen, ökonomischen und institutionellen Arrangements) nicht meidet und tabuisiert, sondern kognitiv und affektiv auf eine Weise besetzt, die Zustimmung für eine progressive Politik wirbt. Zweitens wird man gehalten sein, eine politische Agenda aufzusetzen, die dieser Wählerbasis ein Leben in Sicherheit ermöglicht.
Wer diesen Annahmen nun reflexhaft widersprechen möchte, sollte zumindest bedenken: ein Alleinstellungsmerkmal der Partei DIE LINKE darin zu sehen, dass sie konsequente Friedenspartei sei, heißt zu konstatieren, dass Frieden u.a. Sicherheit vor Krieg ist und Sicherheit ein wesentliches Merkmal friedlicher Gesellschaften.
Genauso wenig kann man ernsthaft eine Politik der offenen Grenzen für diejenigen, die aus ihrer Heimat fliehen, verteidigen, ohne zugleich einen positiven Begriff von Heimat zu haben. Heimat ohne Deutschtümelei zu denken - darin haben uns möglicherweise Menschen mit Migrationshintergrund etwas voraus und vielleicht besteht darin ein Grund, dass moderne Konservative in der migrantischen Community in Teilen anschlussfähiger sind, als Mitte-Links, denn sie thematisieren sowohl die Ausgestaltung von Möglichkeitsräumen, die (neue) Heimaten bieten, als auch den Appell diese Möglichkeiten zu nutzen, womit Anschlüsse an Tugendbegriffe hergestellt werden sollen, die zur Legitimation des modernen Konservatismus gehören. Was fehlt in diesem Narrativ ist die Thematisierung tatsächlicher ökonomischer Gerechtigkeitsbedingungen, die mehr als Chancengerechtigkeit sein muss, nämlich Chancengleichheit.
Das Postulat „Links ist da, wo keine Heimat ist“, wäre demnach abzulösen durch die empathische Aussage: „Links ist da, wo Menschen eine sichere Heimat (auch in der Fremde), damit Zukunft und Möglichkeitsräume“ haben. In diesem Sinne birgt die Diskussion um die Heimat für die politische Linke mehr Möglichkeiten, als die reflexhafte Abwehr zur Selbstvergewisserung.
***
Verwendete Literatur
Abusch, Alexander 1950, Der Irrweg einer Nation, Berlin-DDR.
Arndt, Ernst Moritz 1993, Über Volkshaß und über den Gebrauch einer fremden Sprache, in: Jeismann, Michael/Ritter, Henning (Hrsg.), Grenzfälle. Über neuen und alten Nationalismus, Leipzig, S. 328-330.
Bannas, Günter 2014, In der Erinnerung zusammengewachsen, http://www.faz.net/aktuell/politik/25-jahre-deutsche-einheit/willy-brandts-zitat-zum-mauerfall-ist-wesentlich-aelter-13204476-p2.html. Zuletzt abgerufen am 20.09.2017.
Behrens, Roger o.J., Anmerkungen zu Blochs Kategorie und Begriff der Heimat, gegen das bloße Wort, einschließlich einer Kritik der um das utopische verkürzten virtuellen Räume des Pop, http://alt.rogerbehrens.net/bloch.pdf. Zuletzt abgerufen am 27.09.2017
Best, Heinrich et al. 2016, Gemischte Gefühle: Thüringen nach der „Flüchtlingskrise“. Ergebnisse des Thüringen-Monitors 2016, https://www.thueringen.de/mam/th1/tsk/thuringen-monitor_2016_mit_anhang.pdf. Zuletzt abgerufen am 20.09.2017.
Best, Heinrich et al. 2014, Die Thüringer als Europäer. Ergebnisse des Thüringen-Monitors 2014, https://www.thueringen.de/mam/th1/tsk/thuringen-monitor_2014.pdf. Zuletzt abgerufen am 20.09.2017.
Bock, Helmut 2007, Was ist des Deutschen Vaterland? 175 Jahre Hambacher Fest, in: UTOPIE kreativ, Heft 200, S. 550-561.
Braun, Volker 1990, Das Eigentum, in: DIE ZEIT Nr. 33
Costadura, Edoardo/Ries, Klaus (Hrsg.) 2016, Heimat gestern und heute. Interdisziplinäre Perspektiven, Bielefeld.
Decker, Gunnar 2015, 1965: Der kurze Sommer der DDR, Berlin.
Fleischauer, Alexander 2010, Die Enkel fechten's besser aus. Thomas Müntzer und die Frühbürgerliche Revolution – Geschichtspolitik und Erinnerungskultur in der DDR, Münster.
Hilbig, Wolfgang 2002, Literatur ist Monolog. https://www.deutscheakademie.de/de/auszeichnungen/georg-buechner-preis/wolfgang-hilbig/dankrede. Zuletzt abgerufen am 20.09.2017.
Hoff, Benjamin-Immanuel 2016, Christinnen und Christen unter der SED-Diktatur, Rede auf dem 23. Tag der Thüringischen Landesgeschichte, http://www.benjamin-hoff.de/de/article/3939.stand-der-aufarbeitung-der-sed-diktatur-durch-die-th%C3%BCringer-landesre-gierung-und-notwendige-betrachtung-der-ungleichbehandlung-und-dis-kriminierung-von-christinnen-und-christen-in-der-ddr.html. Zuletzt abgerufen am 20.09.2017
Hoff, Benjamin-Immanuel 2016, Konservatismus – Bedeutsames Korrektiv gegenüber technologischen Allmachtsphantasien, in: OTZ vom 16. Oktober 2016, http://www.otz.de/web/zgt/politik/detail/-/specific/Benjamin-Hoff-Bedeutsames-Korrektiv-gegenueber-technischen-Allmachtsphantasien-705711712. Zuletzt abgerufen am 23.09.2017.
Hoff, Benjamin-Immanuel / Fischer, Alexander 2016, Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Eine Kritik an politischen Positionen Sahra Wagenknechts ist berechtigt – die Ideologiekritik an mancher Kritik ist notwendig. https://www.freitag.de/autoren/benjamin-immanuel-hoff/links-ist-da-wo-der-daumen-rechts-ist. Zuletzt abgerufen am 27.09.2017
Hosfeld, Rolf 2012, Tucholsky: Ein deutsches Leben, München.
Lenin, Wladimir-Iljitsch 1960, Karl Marx (Kurzer biographischer Abriß mit einer Darlegung des Marxismus, Berlin-DDR, Lenin-Werke, Bd. 21, Berlin-DDR, S. 31-80.
Locke, Stefan 2016, „Gutmenschen“ und „Dunkeldeutsche“. Für viele Ostdeutsche ist die Wiedervereinigung noch immer nicht abgeschlossen, in: FAZ vom 10.11.2016.
Marx, Karl 1961, Rede auf der Jahresfeier des „People’s Paper“ am 14. April 1856, in: MEW, Bd.12, Berlin-DDR, S. 3-4.
Marx, Karl / Engels, Friedrich 1961, Das kommunistische Manifest, in: MEW, Bd. 4, Berlin-DDR, S. 459-493.
Scheunemann, Jan (Hrsg.) 2010, Erinnerungskultur und Geschichtspolitik im geteilten Deutschland. Leipzig.
Wehler, Hans-Ulrich 2003, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 4, München.
Wernicke, Kurt 2000, Der arge Weg der Erkenntnis. Zum Umgang mit dem Preußen-Bild in der DDR, in: Berliner LeseZeichen 12/2000, http://www.luise-berlin.de/lesezei/blz01_01/blz00_12/text05.htm. Zuletzt abgerufen am 20.09.20197.

Ich bin Vater, Politiker und Sozialwissenschaftler. Herausgeber von "Neue Wege gehen. Wie in Thüringen gemeinsam progressiv regiert wird" (VSA-Verlag 2023).
Hier veröffentliche ich regelmäßig Beiträge in meinem Blog und andere Publikationen.