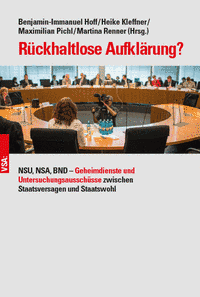Negative Dialektik der ostdeutschen Arbeitsspartaner
Am 16. Oktober 1989 versammelten sich nach den Friedensgebeten in Leipzig 100.000 bis 120.000 Menschen zur bis dahin größten Montagsdemonstration der DDR. Ob es zu einer »chinesischen Lösung« kommen würde, war bis zu diesem Abend offen. Zur Erinnerung: Seit dem April 1989 hatten Studierende nach dem Tod des reformorientierten Politikers Hu Jaobang den Platz des Himmlischen Friedens, den Tiananmen-Platz besetzt. In der Nacht zum 4. Juni 1989 ging das chinesische Militär mit Panzern und scharfer Munition gegen die Demonstrierenden vor. Es gab zahlreiche Tote, deren genaue Zahl bis heute unbekannt ist.
Nach dem was wir heute wissen, soll Erich Honecker den Waffeneinsatz angeordnet und ein Panzerregiment nach Leipzig verlegt haben. Es standen Blutkonserven bereit, Krankenhäuser und Lazarette waren auf den Massenanfall von Verwundeten vorbereitet worden. Dass es dazu nicht kam lag daran, weil Einige Verantwortliche verantwortliche Entscheidungen trafen.
In der DDR wurde damit die transformative Kraft real, die Ton Steine Scherben bereits Anfang der 1970er Jahre im bekannten Song »Allein machen sie dich ein« beschrieben:
„Zu hundert oder tausend kriegen sie langsam Ohrensausen
Sie werden zwar sagen: „Das ist nicht viel“
Aber tausend sind auch kein Pappenstiel
[...]In dem Land, in dem wir wohnen
Sind aber 'n paar Millionen
Wenn wir uns erstmal einig sind
Weht, glaub' ich, 'n ganz anderer Wind.“
Der 16. Oktober 1989 war der bedeutsame Tag, in dessen Folge das, was im September 1989 in Leipzig begonnen hatte, keine blutige, sondern eine friedliche Revolution wurde.
In den darauffolgenden 48 Stunden wurde Honecker abgesetzt und durch Egon Krenz ersetzt. Die Revolution wurde unaufhaltbar. Drei Wochen später am 4. November 1989 versammeln sich etwa 600.000 Menschen zur größten Massendemonstration der Geschichte der DDR. Sie huldigen erstmals seit 1953 nicht der SED. Neben Vertretern politischer Parteien sprechen insbesondere die Intellektuellen. Künstler:innen, Schriftsteller:innen. Einige der dort vorgetragenen Positionen wurden zu ikonograpfischen Forumulierungen. Zum Beispiel Stefan Heym: »Es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen«, Christa Wolf: »Stell dir vor, es ist Sozialismus, und keiner geht weg«.
Vom Dramatiker Heiner Müller ist das Zitat in Erinnerung geblieben: »Wenn in der nächsten Woche die Regierung zurücktreten sollte, darf auf Demonstrationen getanzt werden.«
Bedeutsamer als dieser persönliche Nachsatz ist rückblickend jedoch, dass Heiner Müller mit ziemlich prophetischer Weitsicht vorhersagte, wohin die Reise des Transformationsprozesses gehen würde. Diese Dimension dürfte wohl nur wenigen der 600.000 Demonstrierenden klar geworden sein. Auch mir kam dieses Zitat erst wieder in Erinnerung als ich es jüngst in Klaus Lederers Buch »Mit Links die Welt retten. Für einen radikalen Humanismus« wiederfand.
„Die nächsten Jahre werden für uns kein Zuckerschlecken. Die Daumenschrauben sollen angezogen werden. Die Preise werden steigen und die Löhne kaum. Wenn Subventionen wegfallen, trifft das vor allem uns. Der Staat fordert Leistung. Bald wird er mit Entlassung drohen. Wir sollen die Karre aus dem Dreck ziehen. Wenn der Lebensstandard für die meisten von uns nicht erheblich sinken soll, brauchen wir eigene Interessenvertretungen.“
Drei Tage zuvor war Harry Tisch, der langjährige Vorsitzende des DDR-Gewerkschaftsverbandes (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund, FDGB) zurückgetreten. Er wurde Ende November 1989 aus dem FDGB ausgeschlossen. Seine Nachfolgerin Annelies Kimmel kündigte Reformen an und wollte den FDGB aus der Abhängigkeit von der SED herausführen. Diese Bemühungen scheiterten. Der FDGB hatte sich als Transmissionsriemen der SED ebenso diskreditiert wie als Institution, die nicht die Interessen der lohnabhängig Beschäftigten repräsentierte, sondern vielmehr die von Partei- und Staatsführung dekretierten Produktivitätssteigerungskampagnen exekutierte. Die diskreditierende Wirkung der Gewerkschaftsarbeit ist in Ostdeutschland in der Generation sogenannter gelernter DDR-Bürger:innen bis heute in einer Distanz zu gewerkschaftlicher Organisierung spürbar.
Tiefgreifende Umwälzung der ostdeutschen Arbeitsgesellschaft
Der Transformationsprozess im Anschluss an die Friedliche Revolution bestätigte und übertraf die von Heiner Müller prophezeiten Befürchtungen. Nach der Wende, wie die Friedliche Revolution auch bezeichnet wird, erlebte Ostdeutschland eine tiefgreifende Umwälzung der Arbeitswelt, die in den 1990er und frühen 2000er Jahren zu massiver Arbeitslosigkeit führte. Die Arbeitslosenzahlen stiegen ab 1991 rapide an und erreichten 2003 ihren Höhepunkt mit 1,6 Millionen Arbeitslosen und einer Arbeitslosenquote von 20,1 Prozent.
Dieser Anteil wäre noch weitaus höher ausgefallen, wenn nicht viele Ostdeutsche Arbeit in den alten Bundesländern gesucht oder vorzeitig in den Ruhestand gegangen wären. Besonders stark betroffen von Arbeitslosigkeit waren die jüngeren Generationen, insbesondere jene, die in den 1980er Jahren geboren wurden. Diese Altersgruppe stellte den größten Anteil der Abwanderer in den Westen dar, was langfristige Folgen für die betriebliche Altersstruktur in Ostdeutschland hatte, da der Generationenwechsel in den Unternehmen erheblich gestört wurde.
Ein besonders markanter Aspekt war die hohe Arbeitslosigkeit unter Frauen, die in den ersten Nachwendejahren doppelt so hoch war wie bei Männern. Für eine Gesellschaft, in der die Erwerbstätigkeit von Frauen als selbstverständlich und als Ausdruck von Fortschritt und Emanzipation galt, war dies ein einschneidender und als Rückschritt empfundener Einschnitt.
Die massenhafte Arbeitslosigkeit wurde zu einer beängstigenden Erfahrung, die nicht nur diejenigen prägte, die direkt betroffen waren. Selbst Menschen, die ihre Anstellung behalten konnten, lebten in ständiger Angst, ihre Arbeit zu verlieren, da sie in ihrem sozialen Umfeld – durch Freunde, Kollegen oder Nachbarn – Zeuge der Arbeitslosigkeit wurden. Diese allgegenwärtige Bedrohung und die Entwertung der beruflichen Qualifikationen führten zu einem tiefen Gefühl der Kränkung in der ostdeutschen Arbeitsgesellschaft. der langjährig in Thüringen als Leiter der Arbeitsmarktabteilung und Sozialwissenschaftler tätige Michael Behr spricht in diesem Zusammenhang von einer einzigartigen Erfahrung in Deutschland, bei der viele Ostdeutsche das Gefühl hatten, dass ihre Qualifikationen nichts mehr wert waren.
Diese Situation führte zu einer tiefen Spaltung der Arbeitsgesellschaft in zwei Gruppen. Einerseits gab es die sogenannten »angstbeschleunigten« Arbeitnehmer:innen, die ihre Stellen behalten konnten und aufgrund der permanenten Angst vor Arbeitsplatzverlust bereit waren, große Anstrengungen zu unternehmen, um in den Unternehmen zu verbleiben. Andererseits standen die »zwangsentschleunigten« qualifizierten Arbeitslosen, deren Fachkenntnisse entwertet wurden. Die Angst vor Arbeitslosigkeit disziplinierte die Beschäftigten und schuf eine Situation, in der diese versuchten, alles zu tun, um Personalwechsel zu vermeiden und den Rückgriff auf die zwangsentschleunigten Arbeitslosen unnötig zu machen.
Aus dieser Lage entwickelte sich ein spezifisch ostdeutscher Arbeitscharakter, den Behr als »Arbeitsspartaner« bezeichnet. Dieser Typus von Arbeitnehmer zeichnete sich durch seine Bereitschaft aus, auch unter schwierigen Bedingungen hohe Leistungen zu erbringen und persönliche Interessen stark zurückzustellen. Emotionale Bedürfnisse oder gesundheitliche Aspekte spielten kaum eine Rolle. Gleichzeitig wurden soziale Beziehungen im betrieblichen Umfeld zunehmend funktionalisiert, was zu einer »Deshumanisierung« des Arbeitsalltags führte. Fragen wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder die Berücksichtigung von Betreuungs- und Pflegeaufgaben gerieten in den Hintergrund.
Eine weitere Folge der Arbeitsmarktlage war die Entstehung von »Notgemeinschaften« in den Betrieben. Diese Gruppen, bestehend aus Arbeitnehmern und Geschäftsführern, bildeten sich in der chaotischen Zeit nach der Wende, um gemeinsam zu überleben. Sie verwandelten sich in sogenannte »Bleibekollektive«, die aufgrund mangelnder Alternativen gezwungen waren, zusammenzuarbeiten. Diese Kollektive zeichneten sich durch hohe Leistungsanforderungen, eine starke Gemeinschaftsorientierung und eine oft autokratisch-paternalistische Führungskultur aus. Gleichzeitig gab es wenig Mitbestimmung durch Betriebsräte oder Gewerkschaften, und demokratische Beteiligungsstrukturen blieben schwach ausgeprägt.
Das gemeinsame Ziel dieser Notgemeinschaften war der Erhalt der Betriebe und der Arbeitsplätze. In vielen ostdeutschen Klein- und Mittelbetrieben bedeutete dies, dass sowohl die Geschäftsführung als auch die Belegschaft vor denselben Risiken standen. Der Konkurs eines Unternehmens hätte sowohl für die Arbeitnehmer als auch für die Geschäftsführer den Verlust der sozioökonomischen Grundlage bedeutet. Diese geteilte Bedrohung führte zu einer besonderen Dynamik: Die Beschäftigten waren bereit, ihre Arbeit im Interesse des Unternehmens zu optimieren, ohne dass dafür besondere Anreize notwendig waren. Die enge Verbindung zwischen persönlichem Schicksal und Unternehmen prägte das Arbeitsleben in vielen Betrieben und führte zu einer spezifischen ostdeutschen Arbeitskultur, die auf hohem Engagement und einem starken Gemeinschaftsgefühl basierte.
Diese tiefgreifenden Entwicklungen prägten nicht nur die Arbeitsbeziehungen, sondern auch das Lebensgefühl einer ganzen Generation von ostdeutschen Arbeitnehmern und Unternehmern, die sich in einem stark asymmetrischen Arbeitsmarkt wiederfanden. Der permanente Druck, Arbeitslosigkeit zu vermeiden, und die Entwertung von Qualifikationen hinterließen bleibende Spuren in der ostdeutschen Arbeitsgesellschaft.
Negative Dialektik der ostdeutschen Arbeitsspartaner
Die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns, Manuela Schwesig (SPD), erinnerte vor einigen Tagen beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin in sehr persönlichen von ihrer Erinnerung an den Transformationsprozess, die Nachwendezeit und die Unsicherheiten aus der allgegenwärtigen Massenarbeitslosigkeit:
Ich habe das selbst erlebt, als mein Vater damals arbeitslos wurde, weil sein Betrieb geschlossen wurde. Wir dürfen nicht vergessen: Für die meisten Menschen in den westdeutschen Ländern änderte sich durch die Deutsche Einheit nicht viel. Aber für uns Menschen in Ostdeutschland veränderte sich hingegen fast alles.
Es ist angesichts dieser Erfahrungen nachvollziehbar, dass die Sorge, das Erreichte könne wieder verloren gehen, in Ostdeutschland ausgeprägter ist.
Schwesig gehört zur Generation, die in der Wendezeit zwischen 10 und Anfang 20 Jahre alt war. Diese Generation nimmt heute eine zentrale Rolle auf dem ostdeutschen Arbeitsmarkt ein. Behr nennt sie »kritische Optionisten«, da sie sich von den älteren Generationen dahingehend unterscheidet, nicht von der Entwertung der in der DDR erworbenen Qualifikationen betroffen zu sein und sich schneller auf die neuen Verhältnisse einstellen konnte. Während ihre Eltern oft in autoritären Unternehmensstrukturen verharrten und mangels Alternativen loyal blieben, gingen die »kritischen Optionisten« flexibler mit der Arbeitswelt um.
Gleichzeitig bleibt jedoch die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen bestehen, auch wenn sich die Beschäftigungsquoten angeglichen haben. Frauen sind nach wie vor in prekären Teilzeitverhältnissen gefangen, was Behr als eine Fortsetzung der Mechanismen beschreibt, die auch in den alten Bundesländern die berufliche Gleichstellung behindern. Ostdeutsche Frauen tragen einen Großteil der Verantwortung in Haushalt und Erziehung, sind jedoch im Arbeitsmarkt oft im unteren mittleren Management gefangen, ohne dass sich ihr zusätzlicher Arbeitsaufwand finanziell spürbar lohnt.
Es prägt sich, wie Behr es nennt, »negative Dialektik des ostdeutschen Arbeitsspartaners« aus, also jener Generation, die nach der Wende unter schwierigen Bedingungen hohe Leistungen erbrachte. Diese Arbeitnehmer:innen sehen sich heute sowohl einer fortbestehenden Ungleichheit gegenüber den alten Bundesländern als auch neuen Ungerechtigkeiten gegenüber, da die jüngeren Generationen dank des Fachkräftemangels bessere Bedingungen vorfinden. Der einst als Vorteil gepriesene Niedriglohnsektor Ostdeutschlands wird nun zum Nachteil, was zu einem Gefühl der Enttäuschung und Abgehängtheit führt. Diese Frustration äußert sich zunehmend kollektiv, da die »wunschlos Unglücklichen«, wie Behr sie nennt, ihren lang angestauten Unmut öffentlich machen.
Geteilte Erzählungen, unterschiedliche Erfahrungen gesamtdeutscher Entwicklungen
In der Diskussion um die Erfahrungen von Arbeitnehmern in Ost- und Westdeutschland, insbesondere im Zusammenhang mit den Schließungen von Industriebetrieben in den 1990er und 2000er Jahren, wird deutlich, dass diese häufiger als nach Ost und West getrennt erzählt werden. Dafür gibt es Gründe, denn die die Schließungen von Betrieben in Ost- und Westdeutschland führten zwar zu ähnlichen Herausforderungen aber einer sehr differenzierten Umsetzung.
Der Verlust von Arbeitsplätzen und der notwendige Strukturwandel, bei dem ganze Regionen ihre wirtschaftliche Ausrichtung neu definieren mussten, prägten beide Landesteile. In beiden Fällen gab es auch Bemühungen, den Arbeitsplatzabbau sozial abzufedern, etwa durch Frühverrentungsprogramme und Umschulungen. Allerdings verliefen die Prozesse nicht gleich. Denn im Osten erfolgte der Strukturwandel wesentlich abrupter und umfassender, während er sich im Westen über einen längeren Zeitraum streckte. Der Westen konnte dabei auf frühere Erfahrungen in Anpassungsprozessen zurückgreifen, während der Osten mit einer völlig neuen Situation konfrontiert war. Diese Unterschiede führten dazu, dass die Wahrnehmung der Ereignisse oft getrennt blieb, wie etwa die Beispiele der Kaliwerke in Bischofferode im Osten und des Steinkohleabbaus im Ruhrgebiet im Westen verdeutlichen.
Ein Beispiel für den unterschiedlichen Verlauf dieser Prozesse ist der Ausstieg aus der Steinkohle. In Nordrhein-Westfalen wurde der Abbau über viele Jahrzehnte langsam reduziert, was es ermöglichte, etwa 80.000 Beschäftigte sozialverträglich aus der Steinkohle herauszuführen, ohne dass es zu großen Arbeitslosenzahlen kam. Dieser Prozess verlief schrittweise und unter enger Einbindung der Gewerkschaften, was den Übergang erheblich erleichterte. Im Gegensatz dazu erfolgten ähnliche Prozesse in Ostdeutschland häufig schneller und ohne die umfangreiche gewerkschaftliche Unterstützung, was zu größeren sozialen Verwerfungen führte.
Trotz vieler ähnlicher Herausforderungen in Ost und West wurden diese Erfahrungen jedoch selten als gemeinsame Geschichte verstanden. Die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen und der zeitliche Ablauf führten zu einer getrennten Betrachtung der Prozesse. Eine stärkere Betonung der gemeinsamen Aspekte könnte jedoch dazu beitragen, ein besseres gegenseitiges Verständnis zu entwickeln und die industrielle Geschichte und den Strukturwandel in Deutschland als gesamtdeutsches Thema zu begreifen.
Fortbestehende Besonderheiten Ost
In Ostdeutschland ist auch eine Generation nach der Friedlichen Revolution die Tarifbindung schwächer ausgeprägt als in den alten Bundesländern, was zu prekären Arbeitsverhältnissen und geringeren Löhnen führt. Der jährlich im Auftrag der Thüringer Landesregierung erhobene Thüringen Monitor hält fest:
Insgesamt arbeiten die Thüringer:innen durchschnittlich 30 Minuten pro Woche länger als in Westdeutschland, erhalten dafür aber 600 EUR weniger als im Bundesdurchschnitt. 56 Prozent der Beschäftigten empfinden ihr Gehalt als „nicht leistungsgerecht“ (bundesweit: 46 Prozent) und 45 Prozent als „nicht ausreichend“ (bundesweit: 38 Prozent). Nur ein Fünftel der Unternehmen haben Tarifbindung; bei Einbeziehung der Unternehmen ohne Tarifbindung, die sich bei den Gehältern aber am Branchentarif ausrichten, sind es knapp die Hälfte der Unternehmen. Einen Betriebsrat haben nur 8 Prozent der Thüringer Unternehmen, doch da dies die größeren Unternehmen sind, arbeiten immerhin 41 Prozent der Thüringer Beschäftigten in einem Unternehmen mit Betriebsrat.
Zwischen der Demokratiefrage und der sozialen Frage besteht ein elementarer Zusammenhang. Deshalb muss es für uns alle, die wir in Thüringen in unterschiedlicher Form Verantwortung tragen und Verantwortung übernehmen, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Vertretung der Interessen der lohnabhängig Beschäftigten darum gehen, dass die Tarifbindung erhöht und die Lohnlücke geschlossen wird. Knapp zwei Drittel der im Thüringen-Monitor Befragten sprechen sich zudem dafür aus, in Branchen mit Fachkräftemangel besser zu entlohnen.
Flächentarifverträge und Branchenmindestlöhne könnten Lohndumping verhindern und für gerechte Löhne sorgen.Dies wird nicht durch Gesetze entschieden, sondern durch die Sozialpartner, also starken und hoffentlich noch stärker werdenden Gewerkschaften sowie den Arbeitgeberverbänden. Sie spielen eine zentrale Rolle in diesem Prozess, indem sie die kollektive Interessenvertretung übernehmen und eine Plattform für soziale Kompromissbildung bieten. Ansätze für tripartistische Kooperationen zwischen Staat, Arbeitgebern und Gewerkschaften, die darauf abzielen, die Bevorzugung von Arbeitgeberinteressen zu korrigieren und bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen, bestehen, sind aber zu gering ausgeprägt. Solche korporatistischen Strukturen zukünftig eine noch größere Rolle spielen zu lassen wäre bedeutsam, um die Qualität der Arbeit zu verbessern. Dazu gehören angemessene Bezahlung, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen.
Eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen wird ohne kollektive Interessenaushandlung schwer zu erreichen sein. Wo es keine starken Mitbestimmungs- und Tarifstrukturen gibt, dominieren individuelle Strategien wie Job-Hopping oder die Zurückhaltung von Leistung. Gewerkschaften bieten den notwendigen institutionellen Rahmen, um diese Defizite zu beheben und die Interessen der Lohnabhängigen effektiv zu vertreten.
Auch die betriebliche Personalpolitik muss sich verändern, um eine Abwanderung zu verhindern und die demografische Krise abzumildern. Eine arbeitnehmerorientierte Gestaltung der Arbeit, die Gesundheit und Wohlbefinden fördert, ist hierbei essenziell. Gleichzeitig muss die Einbindung der Beschäftigten in betriebliche Entscheidungen und Mitbestimmungsprozesse flächendeckend gestärkt werden. Unternehmen, die tarifgebunden sind und auf Mitbestimmung setzen, dienen bereits als positive Beispiele, doch diese Modelle müssen verbreitet werden. Eine stärkere Tarifbindung und aktive Gewerkschaftsarbeit könnten helfen, Fachkräfte zu halten und den Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte zu regulieren.
Einwanderungsgesellschaft Ost
Auch wenn die Wahlergebnisse in Sachsen, Thüringen und Brandenburg die AfD gestärkt und die ostdeutsche Gesellschaft sowie der öffentliche Diskurs nach rechts gerückt ist, kann niemand die Augen davor verschließen, dass die Migrationspolitik eine wichtige Rolle spielt, den demografischen Wandel abzufedern.
Die Zahl der aus dem Ausland kommen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Thüringen ist in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau angestiegen. Sie kommen aus mehr als 150 Herkunftsländern. 3.749 davon waren übrigens Ukrainerinnen und Ukrainer. All diese Menschen tragen dazu bei, unseren Freistaat, unsere Wirtschaft am Laufen zu halten. Sie gehören genauso zu den Fleißigen in diesem Land wie diejenigen, die zusätzlich zum Bürgergeld aufstocken müssen oder diejenigen, die noch unbezahlte Care-Arbeit leisten. Fleiß ist eine Tugend – wir sollten sie fördern, nicht als Hebel zur gesellschaftlichen Spaltung nutzen.
Alle haben einen Nutzen von der Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Die Gewerkschaften ebenso wie die Arbeitgeber in Thüringen und anderen ostdeutschen Ländern haben diese Realität erkannt. Sie erwarten von der Politik die Rahmenbedingungen für die Zuwanderung von Arbeits- und Fachkräften. Für die gelingende Integration derjenigen, die im Wege der Arbeitsmigration zu uns kommen, ebenso wie der Menschen, die bereits bei uns leben.
Die Region für ausländische Fachkräfte attraktiver zu machen und Fachkräfte bzw. Auszubildende aus dem Ausland anzuwerben, finden jeweils rund zwei Drittel der Befragten im Thüringen-Monitor sehr geeignet bzw. eher geeignet. Ein Drittel hält dies für eher ungeeignet oder gar nicht geeignet.
Selbst bei denjenigen, die sich politisch rechts einordnen und dementsprechend migrationskritisch sind, sieht die Hälfte der Befragten die Notwendigkeit, unsere Region für ausländische Fachkräfte attraktiver zu machen und im Ausland um Arbeitskräfte und Auszubildende zu werben.
Die häufigsten Vorschläge der im Thüringen-Monitor Befragten, um die Integration von Geflüchteten oder Migrant:innen in den Arbeitsmarkt zu fördern, sind Sprachkurse sowie die einfachere und zügigere Erteilung der Arbeitserlaubnis sowie die vereinfachte Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen.
Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik, Sozialpartnern und Gewerkschaften. Sie sind nicht alles, aber ohne sie ist das Meiste zu wenig.

Ich bin Vater, Politiker und Sozialwissenschaftler. Herausgeber von "Neue Wege gehen. Wie in Thüringen gemeinsam progressiv regiert wird" (VSA-Verlag 2023).
Hier veröffentliche ich regelmäßig Beiträge in meinem Blog und andere Publikationen.